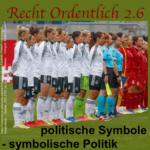Autor: admin
-
Bundestagswahlen 2025 – R.O. #2.10 & #2.11
Zwei Weltprämieren bei Recht Ordentlich: Daniel Andrae und Thomas M. Schimmel begrüßen erstmalig einen Gast in ihrem Podcast und erstmals gibt es eine Doppelfolge. Die Folge wurde aufgenommen am 17. Januar […]
-
Jahresrückblick 2024 – R.O. #2.9
Sie sitzen zwar nicht mit Robert am Küchentisch, sondern im Homeoffice von Daniel in Markkleeberg, dennoch unterhalten sich in dieser Folge Daniel und Thomas angeregt über die politischen Ereignisse des […]
-
Wehrhafte Demokratie – R.O. #2.8
Die Demokratie ist die einzige Herrschaftsform, die sich selbst in Frage stellt und in der die Herrschenden Opposition zulassen. Gleichzeitig steckt die Demokratie immer in einem Dilemma: Kann sie zulassen, […]
-
Neutralität – R.O. #2.7
Muss man eigentlich als Dozent oder als Dozentin an einer Hochschule neutral sein? Oder darf man auch mal seine Meinung sagen? Wie ist das mit Studierenden und Dozierenden, die parteipolitisch […]
-
Politische Symbole – symbolische Politik – R.O. #2.6
Diese Ausgabe unseres Podcastes wurde am 7. November 2024, dem Tag nach dem Bruch der Ampel-Koalition und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten aufgenommen. Natürlich gehen Daniel Andrae und Thomas […]
-
Der Osten und der Westen – R.O. #2.5
Daniel Andrae und Thomas Schimmel unterhalten sich heute über das Phänomen, dass es im Osten viele Menschen gibt, die sich aktiv als Ostdeutsche bezeichnen, dass aber im Westen sich nur […]
-
Expertokratie?! – R.O. #2.4
Nach den Wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen ist allen klar, dass die Regierungsbildungen schwierig werden und zu Zerreißproben in den Parteien führen könnten. Insgesamt hat Politik und haben Politiker*innen […]
-
Dysfunktion der Verwaltung – R.O. #2.3
Klagen allerorten: Deutschland funktioniert nicht. Die Verwaltung funktioniert nicht. Manche sprechen schon vom failed state Germany. Alles ist zu langsam. Infrastruktur verfällt. Der Öffentliche Dienst hat ein schlechtes Image. Daniel […]
-
Föderalismus – R.O. #2.2
In dieser Folge unterhalten sich Daniel und Thomas über den Föderalismus in Deutschland. Geht es am Anfang noch um Gründe und Ursprünge der föderalen Struktur der Bundesrepublik (und der DDR), […]
-
Medien und Wahl – R.O. #2.1
Die Wahlen in Thüringen und Sachsen liegen hinter uns und die Wahlen in Brandenburg liegen vor uns. Daniel Andrae und Thomas M. Schimmel unterhalten sich in dieser ersten Folge nach […]

- Olympia wieder in Deutschland? R.O. - #3.7
- Macht - R.O. #3.6
- Regeln, die keiner braucht – R.O. #3.5
- Feministische Außenpolitik – R.O. #2.4
- NGOs und 551 Fragen - R.O. #3.3
- Zwei-Themen-Folge: Zwickau - Stadt des Friedens und Fasten vor Ostern und zum Ramadan - R.O. #3.2.
- Erratic New World - R.O. #3.1
- Bundestagswahl 2025 - R.O. #2.10
- Bundestagswahl 2025 (II) - R.O. #2.11
- Jahresrückblick 2024 - R.O. #2.9
Recht Ordentlich auf anderen Plattformen:
Apple: Hier klicken.
PocketCasts: Hier klicken.
podcast.de: Hier klicken.
Podcast Republic: Hier klicken.
Podscan.fm: Hier klicken.
Recht Ordentlich Episoden …
… ohne Spotify, Apple & Co: Hier klicken. (Hinweis: Klick auf den Episodentitel öffnet Audio-Player.)