Feminismus in der DDR
Auszug aus: Arndt, Susan: «Ich bin ostdeutsch und gegen die AfD. Eine Intervention» , Kap. 2. (E-Book), München 2024. Mit freundlicher Genehmigung des C.H. Beck-Verlages.
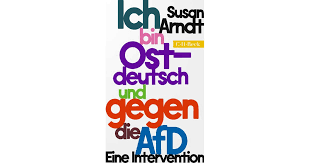
„Was die «Frauenfrage» angeht, so war die DDR-Verfassung deutlich konsequenter als das Grundgesetz. Die Gleichberechtigungsklausel von Mann und Frau wurde ergänzt um die folgende konsequente Formulierung: «Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben.» Das griff die Verfassung von 1968 in Artikel 20 wie folgt auf: « (2) Mann und Frau sind gleichberechtigt und haben gleiche Rechtsstellung in allen Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und persönlichen Lebens. Die Förderung der Frau, besonders in der beruflichen Qualifizierung, ist eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe.» Zwar dauerte es auch in der DDR noch etwas, bis alle Paragrafen und Gesetze der Verfassung folgten und alle de-facto-Praktiken den de-jure-Bestimmungen angepasst wurden. Das Letztentscheidungsrecht des Mannes aber, das in der Bundesrepublik weiter bestand, wurde in der DDR ohne Einschränkung abgeschafft. Dieser deutliche Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Frauen, die sich eben auch als Möglichkeit zu wirtschaftlicher Autonomie auswirkte, war eine gern gespielte Trumpfkarte der DDR.
Die Emanzipation der DDR-Frau im Vergleich zur Frau in der Bundesrepublik wurde maßgeblich daran festgemacht, dass sie «arbeiten durfte». Zum einen änderte das nichts daran, dass der Gender-Pay-Gap deutlich und Frauen in Leitungs- und Machtfunk“ „Machtfunktionen systematisch unterrepräsentiert waren. Zum an deren durften Frauen nicht nur arbeiten. Es wurde von ihnen erwartet.
Es stimmt zwar, dass aus dieser Berufstätigkeit die Möglichkeit erwuchs, ökonomisch unabhängig vom Mann zu leben. Andererseits aber war die Berufstätigkeit der DDR-Frau selbst nicht gleichbedeutend mit Emanzipation oder gar Freiheit bzw. Autonomie. Ob Frauen in der DDR wirklich gleichberechtigter, selbstbewusster und selbstbestimmter waren als in der Bundesrepublik, muss letztlich immer auch in Relation beantwortet werden. Denn vielleicht hatte sie mehr Autonomie in der Familie oder durch wirtschaftliche Unabhängigkeit, aber wie viel Selbstbestimmtheit kann eine Diktatur insgesamt überhaupt zulassen? Am Ende blieben alle DDR-Frauen in einer Diktatur gefangen und waren in dieser einer Dreifachbelastung unterworfen: Neben Berufstätigkeit gab es das obligatorische gesellschaftliche Engagement (etwa in SED oder FDGB). Selbst wer dem nicht nachkommen wollte, musste für diesen kleinen Widerstandsakt Energie aufwenden. Drittens leisteten Frauen weitgehend allein die gesamte Haus- und Erziehungsarbeit. Unbezahlt. Denn stereotype Familienrollen blieben intakt. Diese wurde nur durch einige wenige Schutzgesetze für Mütter versüßt. Neben einem Haushaltstag pro Monat war das ein Anspruch auf Mutterschutz- oder Erziehungszeit. Zudem gab es sozialpolitische Strategien für junge Ehen und vor allem in Ehen geborene Kinder. Das aber führte zu frühen Heiraten […] “„aus, aber patriarchalisch geprägte Schönheitsdogmen prägten auch DDR-Blicke auf Frauen.
Obwohl die Stellung der Frau letztlich insgesamt eine Trumpfkarte für die DDR war, hatte Sexismus dort nichts an Präsenz eingebüßt. Das spricht auch aus Heiner Carows DDR-Kultfilm «Die Legende von Paul und Paula» (1973). Er erzählt von der Liebe eines verheirateten SED-Funktionärs auf höherer Ebene und einer alleinstehenden Mutter, die als Kassiererin arbeitet. Paula bezahlt ihre Leidenschaft mit dem Tod eines ihrer Kinder. Diese Szene schmerzte mich so sehr, dass ich mir den Film nie wieder anschauen kann. Dieser Schmerz nährte aber auch die Empörung darüber, dass Paul sich für seine Karriere entscheiden und in das Wohnzimmer zurückkehren kann, in dem seine Ehefrau als handlungsunwillige Statue festgenagelt scheint. Carows Film erzählt diese Geschichte ohne feministische Ambition wie nebenher mit. Und doch verstand ich, dass die DDR, gerade weil sie in ihren wichtigsten Strukturen vor allem Männer platzierte, weit davon entfernt war, patriarchalische Strukturen abbauen zu wollen. Entsprechend wurde Feminismus entlang der Linie, dass die ‹Frauenfrage› geklärt war, verboten. Jede feministische Gruppe empfand die SED-Diktatur als Angriff auf seine Staatsdoktrin. Und so stand etwa auch im Duden der DDR unter Feminismus, dass dies eine «weibliche Eigenschaft bei Männern sei».
Susan Arndts Buch ist zu erwerben im Shop des Beck-Verlages oder in jeder Buchhandlung.

